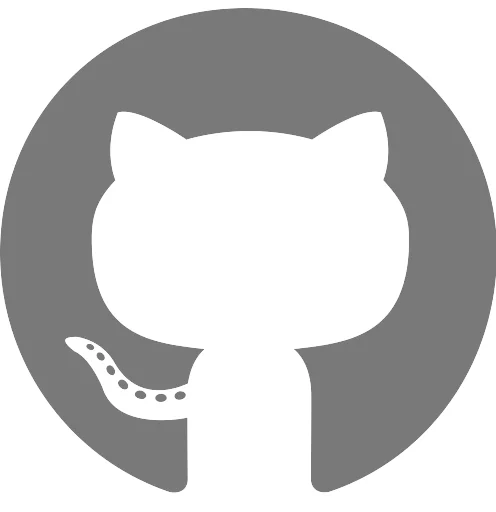Solvathons treiben die Diagnose seltener Krankheiten voran
- 09 Sept. 2025
- Vicente Yépez
Trotz diagnostischer Fortschritte auf Basis von Genomdaten bleibt der Großteil der Menschen mit seltenen Erkrankungen ohne bestätigte Diagnose. Neue Omics-Technologien wie Long-Read-Sequenzierung, optisches Genom-Mapping und Multi-Omics-Profiling steigern zwar die Erfolgsraten, erhöhen jedoch auch die Komplexität der Analyse.
Um dieser Komplexität zu begegnen, braucht es eine systematische, multidisziplinäre Zusammenarbeit. Ein vielversprechender Ansatz sind gezielte diagnostische Workshops, in denen Kliniker, Wissenschaftler und Bioinformatiker gemeinsam ungelöste Fälle neu analysieren.
Das Solvathon-Modell
Das paneuropäische Solve-RD-Konsortium (2018–2024, gefördert von der EU) entwickelte das innovative Workshop-Format „Solvathon“. Zur Verbesserung der Diagnoseausbeute kombinierten diese strukturierten Veranstaltungen Multi-Omics-Reanalysen mit Expert*innenbeiträgen und praktischer Fallarbeit. Über 100 Partner aus 26 Ländern haben zu dieser Initiative beigetragen. Wie in einem neuen Artikel in Nature Genetics beschrieben, haben vier im Rahmen von Solve-RD durchgeführte Solvathons unmittelbar zu mehr als 100 neuen Diagnosen für Patient*innen mit zuvor ungelösten seltenen Krankheiten beigetragen.
Die Teilnehmenden brachten reale, ungelöste Patient*innenfälle ein, was eine gezielte und effektive Zusammenarbeit förderte. Durch den Einsatz neuester Technologien, fortschrittlicher Datenanalyse-Methoden und wachsender Datenbanken ermöglichten Solvathons nicht nur Diagnosen, sondern dienten auch als zentrale Plattform für Schulungen zur Einführung neuer diagnostischer und forschungsrelevanter Methoden.
Um Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit sicherzustellen, betonte das Solve-RD-Team die Wichtigkeit standardisierter Rahmenbedingungen für Annotation und Interpretation. Detaillierte Protokolle für Datenaustausch, Visualisierung und gemeinsame Analyse sind essenziell, um effektive Zusammenarbeit und Wissenstransfer zwischen Datensätzen und Teams zu ermöglichen.
GHGA- Werkzeuge in der Anwendung
Zwei der vier Solvathons wurden von GHGA-Co-Sprecher Julien Gagneur und seinem Team an der TU München mitorganisiert, während GHGA-Co-Sprecher Holm Graessner alle vier Veranstaltungen betreute. Mithilfe von GHGA-Workflows wie DROP wurden die bioinformatischen NGS-Ergebnisse während der Veranstaltung umgehend aufbereitet und in einer sicheren IT-Infrastruktur veröffentlicht.
Ausblick
Aufbauend auf Solve-RD wird das Solvathon-Modell unter ERDERA , der neuen Europäischen Allianz für seltene Krankheiten, weitergeführt. Mit über 180 Partnern und einem siebenjährigen Horizon-Europe-Mandat soll die Solvathon-Initiative europaweit ausgeweitet werden. Ziel ist die Vernetzung nationaler Programme für nicht diagnostizierte Krankheiten, die Förderung von Schulungen und die Stärkung der grenzüberschreitenden Diagnostik.
Angesichts der zunehmenden Komplexität der Genomik seltener Krankheiten bieten Solvathons eine effektive Plattform, um Expert*innen zu vernetzen, Diagnosen zu verbessern und Patient*innen Zugang zu den neuesten biomedizinischen Innovationen zu ermöglichen.